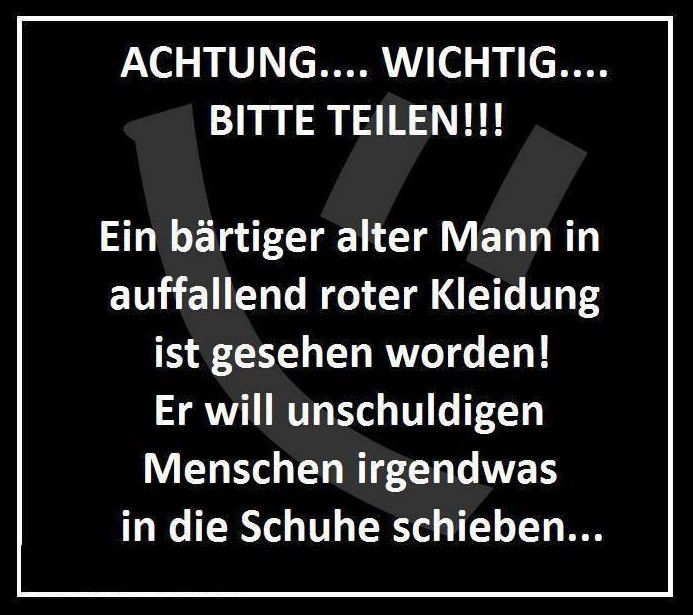oder: „Wer ist hier verhaltensauffällig?“

Die Coronakrise hat mit der sogenannten „neuen Normalität“ die Frage in den Raum gestellt, was eigentlich normal ist und was nicht. Was war die alte Normalität und was ist die neue Normalität? Wie alt muss die Normalität sein, damit sie als normal zu bezeichnen ist und wann ist das Neue normal? Diese Fragen drängen sich mir geradezu auf, weil sie konsequent zu Ende gedacht unweigerlich zu der Antwort führen, dass es für den Begriff „normal“ keine geeignete Definition gibt, obwohl wir ihn ständig mit einer Selbstverständlichkeit gebrauchen und anwenden. Dem Begriff „normal“ liegt natürlich das Verständnis des Normativen zugrunde: Als normal bezeichnen wir das, was die vorherrschende Norm, im Sinne eines Mehrheitsverständnisses, abzeichnet. Gleichzeitig verbinden wir damit meistens aber eine qualitativ-moralische Bewertung: Gut ist, was normal ist, nicht gut ist, was abnormal ist.
Schauen wir uns doch einmal dieses Verständnis von Normalität anhand der aktuellen Zustände auf der Welt durch diese Brille an.
Normal ist…
demnach, dass MANN bestenfalls narzisstische, egomanische, selbstverliebte, machtgierige Persönlichkeitsmerkmale vorweist, um die Wahl zu einem der mächtigsten Staatenführer auf diesem Planeten zu gewinnen, bestenfalls können noch mangelnde Impulskontrolle und das Fehlen jeglicher sozialen und emotionalen Kompetenz aufgeboten werden, damit wäre das Anforderungsprofil dann perfekt erfüllt.
Normal ist, …
dass es solchen Staatsmännern ermöglicht wird jahrelange Bürgerkriege gegen die eigene Bevölkerung zu führen, ohne dass sich eine internationale Gemeinschaft offenbar in der Lage sieht, den grausamen Gemetzeln hier und dort Einhalt zu gebieten. Normal ist offenbar auch, dass der Profit durch den Handel mit Waffen dabei wichtiger ist als die humanitären Katastrophen und das unermessliche Leid von Millionen Menschen, die sich daraus ergeben.
Normal ist, …
dass laut statistischen Zahlen in Österreich die reichsten 20% der Bevölkerung rund 73% des Gesamtvermögens in ihrem Besitz haben, hingegen auf 50% der ärmeren Bevölkerung grade mal 3,6% des Gesamtvermögens fallen. Normal ist auch, dass die, die bereits reich sind sozusagen ohne weiteres Zutun immer reicher werden, wohingegen jene, die arm sind auch mit besonderem Fleiß kaum Chancen haben reicher zu werden.
Normal ist, …
dass es nach wie vor hauptsächlich Männer sind, die in gut bezahlten Spitzenpositionen viel Geld verdienen, während Frauen sich in viel schlechter bezahlten Berufen um die grundlegenden Bedürfnislagen der Gesellschaft bemühen. Auch wenn diese schlecht bezahlten Berufe neuerdings als SYSTEMRELEVANT bezeichnet werden, wird sich in absehbarer Zeit an der monitären Bewertung dieser Leistungen nichts ändern.
Normal ist, …
dass dort, wo der unermessliche ökonomisch motivierte Raubbau Natur und Lebensgrundlagen zerstört, das Recht auf Leben von Tieren, Pflanzen und auch Menschen dem Interesse von Macht und Geld untergeordnet ist.
Normal ist die Sucht nach mehr und mehr Konsum und die damit einhergehende Abhängigkeit und Unmündigkeit, die jeder Sucht zu eigen ist. Normal ist, dass offenbar der Markt alles regelt, wer immer dieser Markt auch sein mag. Normal ist, dass der bequeme Weg bevorzugt wird, zumindest wenn es um gesellschaftliches Engagement geht. Die überschüssigen Energien arbeiten wir dann in unserer Freizeit beim Sport ab. „Ich schau auf mich!“ lautet die Devise, die sich auch als (staatlich verordneter) Leitsatz der aktuellen Krisen-Kampagne wiederfindet. Egoismus vor Gemeinschaftssinn, daran ändert auch die plakative Beschwörung des Zusammenhalts nichts.
Wer all diese Normalität in Frage stellt läuft Gefahr als verhaltensauffällig eingestuft zu werden. Wer sich dieser Normalität entziehen möchte ist ein unrealistischer Spinner, ein Querkopf, ein „Revoluzzer“.
Welche Erziehungsvisionen ergeben sich aus dieser Sichtweise für uns und die Kinder, die uns anvertraut sind? Kann es tatsächlich unser Wunsch sein, dass sich die Kinder immer mehr an diese Form der Normalität anpassen oder wäre es nicht an der Zeit, sie mehr zur „Verhaltensauffälligkeit“ zu ermuntern, in dem Sinne, dass sie sich authentisch verhalten in dem, was ihnen als soziale Wesen mit empathischen Fähigkeiten und der Kompetenz, sich mit der Natur und den darin vorkommenden Wesen zu verbinden, entspricht und im Sinne dessen, dass sie als Wesen von Beginn an mit einem gut funktionierenden moralischen Kompass ausgestattet sind.
Ob alte oder neue Normalität, eine ordentliche Portion Verhaltensauffälligkeit ist für mich in beiden Fällen höchst angebracht!
Birgit Ed(ublogg)er(in)